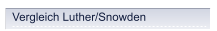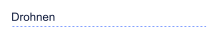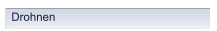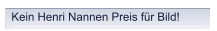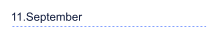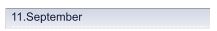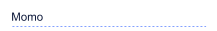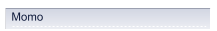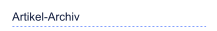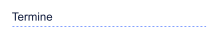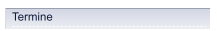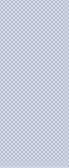






Ewald Heinrich von Kleist über seine Teilnahme am
Widerstand gegen Hitler
„Der Tod war ein großes Thema“
Die frühere Bundestagsvizepräsidentin und Grünen-Politikerin Antje Vollmer sowie "Welt"-Redakteur Lars-Broder Keil haben für ihr gerade erschienenes Buch "Stauffenbergs Gefährten. Das Schicksal der unbekannten Verschwörer" (Hanser Berlin, 256 Seiten, 19,90 Euro) im Jahr 2012 ein letztes Interview mit Ewald Heinrich von Kleist geführt, der am 8. März 2013 mit 90 Jahren gestorben ist. Ewald Heinrich von Kleist war am 20. Juli 1944 in Berlin als junger Offizier beim Staatsstreich gegen Hitler dabei. Das Interview aus dem Buch in Auszügen: Herr Kleist, fällt Ihnen die Erinnerung an den 20. Juli schwer? Ewald Heinrich von Kleist: Früher hatte ich bestimmte Erinnerungen an Ereignisse, von denen wusste ich ganz klar, wie sie waren. Heute ist das nicht ganz so einfach. Inzwischen habe ich so viele Dinge über ein und dieselbe Sache gehört und gelesen, dass ich manchmal schon gar nicht mehr weiß, haben die anderen eigentlich recht oder ich. Es wird vieles auch falsch dargestellt. Außerdem kommen natürlich neue Themen hinzu, die mich mehr interessieren als die alten Sachen. Die sind ja auch mehr als 60 Jahre her. Wo haben Sie sich zur Vorbereitung des Attentats getroffen? Kleist: An verschiedenen unauffälligen Orten, zum Beispiel in Neuhardenberg bei Berlin. Bei den Hardenbergs gab es viele junge Damen... Kleist: Die gab es, aber es gab da auch ein Gästebuch, in das wir uns eintragen sollten. Das war damals so üblich. Ich fand das gefährlich. Am 9. Juli 1944 waren wir noch mal da. Ich habe mich erst geweigert und verdrückt. Da kam die Altgräfin und forderte mich auf, mich auch einzutragen. In dem Buch standen Stauffenberg, Haeften, Klausing … Und das wurde dann bei der Gestapo natürlich nachgefragt. Das war so eine Ausrede für die Gestapo: "Da waren so hübsche Mädchen ..." Kleist kümmerte sich zusammen mit Stauffenbergs Adjutanten Friedrich Karl Klausing im Bendlerblock um den Fortgang des Staatsstreichs. Beide kannten sich aus dem Traditionsregiment I.R.9 in Potsdam. Am Abend des 20. Juli kommt es zu folgendem Dialog: Einmal traf ich ihn auf dem Gang, es war spät, sehr spät, und er sagte: "Komm mal mit!" Ich fragte ihn: "Wo willst du hin?" "Nach oben, meine Pistole holen!" "Was willst du jetzt damit?", fragte ich. Er antwortete: "Ich habe dir immer gesagt, wir schaffen das, wir kommen durch – in Russland und an all den anderen gefährlichen Orten. Aber jetzt sage ich dir: Es ist aus!" Warum waren Sie selbst am 20. Juli im Bendlerblock? Kleist: Man brauchte doch Hilfstruppen, ich war als Ordonnanz vorgesehen. Davor gab es am 11. und 15. bereits Versuche, das Attentat auszuführen. Da standen Sie auch bereit? Kleist: Ja. Sie haben in einem Hotel in der Nähe auf den Einsatz gewartet. Wie fühlt man sich da? Kleist: Nicht sehr angenehm. Und man ist auch aufgeregt. Aber man muss diszipliniert sein. Sie selbst standen Anfang 1944 vor der Entscheidung, für die Tötung Hitlers Ihr eigenes Leben zu geben. Hitler sollte bei einer Uniformvorstellung durch das Auslösen einer Bombe getötet werden. Erst wurde die Vorführung verschoben, dann fiel der vorgesehene Attentäter Axel von dem Bussche wegen einer Verwundung aus, daher wurden Sie gefragt. Wie war das für Sie? Kleist: Unangenehm. Der Tod schreckt kriegserfahrene Soldaten wenig, heißt es. Auch den Teilnehmern des Hitler-Attentats wird nachgesagt, der Tod habe ihnen am wenigsten Gedanken gemacht. Kleist: Das ist ganz falsch. Der Tod war ein gewaltiges Thema. Auch für uns Soldaten. Wenn Sie jung sind, finden Sie den Gedanken an den Tod nicht sehr erfreulich. Sind Sie aus diesem Grund zu Ihrem Vater gegangen und haben ihn um Rat gefragt, ob Sie sich und Hitler töten sollen? Kleist: Ich stand vor der Frage: Sage ich Ja, bin ich tot. Sage ich Nein, bin ich ein Schwein. Beides ist nicht gut. Als Kind schiebt man gern Eltern, die einen lieben, die Verantwortung zu, weil man glaubt, dann fein raus zu sein. Was haben Sie denn für eine Antwort erwartet? Kleist: Erwartungen hatte ich keine. Obwohl, man musste damit rechnen, dass mein Vater mir zurät. Was hat er konkret gesagt? Kleist: "Du musst das tun. Wer in so einem Moment versagt, hat nie wieder Freude am Leben." Aber die Uniformvorführung wurde dann immer wieder verschoben. Wo war Ihr Vater am 20. Juli? Kleist: Zu Hause. Er ist dann wegen mir verhaftet worden. Er kam sozusagen in Sippenhaft. Gleichwohl war auch er involviert in die Staatsstreichplanung. Kleist: Mein Vater war vorgesehen als Politischer Beauftragter für Pommern. Wann und wo haben Sie Ihren Vater noch gesehen? Kleist: Im Gefängnis in der Lehrter Straße. Ich bin einmal zu einer Vernehmung abgeführt worden. Vor der Zentrale musste man sich mit dem Gesicht zur Wand stellen, während der Posten einen anmeldete. Da ging die Haupttür auf, es war dunkel, und ich habe zur Seite gelinst und zwei Leute gesehen, einer kam mir vom Gang und der Statur her bekannt vor, der wurde neben mich gestellt und auch angemeldet. Das war mein Vater. Dann gab es einen Oberaufseher (Oberscharführer), einen Österreicher, der kam eines Nachts in meine Zelle, um sich mit mir zu unterhalten, und gab mir sogar etwas zu essen: Leberwurstbrote mit Butter! Er wollte reden und erzählte mir von seinem Leben und was er als SS-Angehöriger gemacht hatte in Polen, in Dänemark. Unvorstellbar grausame Sachen, die man nicht schildern kann! Und so einer gibt einem sein Leberwurstbrot zu essen! Eines Tages sagt er zu mir: "Hier ist ja noch ein Kleist." Ich blieb gelassen und zeigte keine Reaktion. Dann schaute er nach und meinte: "Das ist ja Ihr Vater. Wollen Sie ihn mal sehen?" Dann wurden wir tatsächlich in eine leere Zelle geführt, mein Vater und ich. Wir waren eine halbe Stunde zusammen. Unglaublich. Das war das letzte Mal. Wollte der Wärter Ihnen Gutes tun? Kleist: Ich nehme nie etwas an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei einem Mann, der so grausam war wie dieser Kerl. Für diese Aktion wäre er erschossen worden, wenn das rausgekommen wäre. Ich habe aber vermutet, dass wir abgehört werden. Worüber haben Sie sich mit Ihrem Vater unterhalten? Kleist: Eigentlich über Nichtssagendes. Wie es einem geht und so weiter. Der Sohn wurde überraschend im Dezember 1944 entlassen. Der Vater, Ewald von Kleist-Schmenzin, wurde am 28. Februar 1945 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und noch kurz vor Kriegsende, am 9. April, in Plötzensee hingerichtet. Wo waren Sie, als das Ende des Staatsstreichs kam? Kleist: Ich sollte Truppen besorgen, nachdem das Wachregiment abgezogen worden war. Deshalb war ich auf der Stadt-Kommandantur. Dann bin ich durch den Tiergarten zurück und hörte es knallen wie von einer Schießerei. Da wurde ich vorsichtig. Dann erinnerte ich mich, dass ich selbst zuvor jemanden zurückgehalten hatte, der aus dem Bendlerblock verschwinden wollte. Da habe ich gedacht, wenn du andere zurückhältst, kannst du selber nicht verschwinden, bevor du nicht wirklich weißt, dass alles zu Ende ist. Also bin ich reingegangen, doch da standen Wachen, und ich wurde sofort verhaftet. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie lebend in der Gestapo-Zentrale ankommen? Kleist: Nein, und ich geniere mich heute sogar etwas, dass ich bei der Einfahrt ins Gefängnis an die Göttliche Komödie dachte. Da steht über dem Tor zur Hölle: "Lasst, die ihr hier eingeht, alle Hoffnung fahren." Mir fiel das wirklich ein, und ich dachte, das ist ja ganz schön, dass ich, bevor ich sterbe, an so etwas denke. Ist das nicht etwas eitel? Nein, gar nicht. Warum soll das eitel sein? Sie waren mit 22 Jahren der jüngste der Beteiligten am Staatsstreich … Wie sind Sie zum Widerstand gekommen? Gab es einen Anlass, eine Person? Kleist: Bei mir waren es das Elternhaus, mein Vater, meine Großeltern und natürlich mein Regiment und dort besonders Fritz von Schulenburg. Der war im Prinzip mein Mentor. Mein Vater war sehr emotional, wie viele in der Anti-NS- Bewegung. Das war eigentlich unvernünftig und wenig zielführend. Man beschimpfte offen die Generalität, aber entscheidend war nur die oberste Heeresführung. Man hat abschätzig über den "Gefreiten aus Braunau" gesprochen, den "Pinselquäler". Das hatte so etwas Ungefährliches. Ich war da schon in jungem Alter sehr realistisch. Mir war klar, eine solche Diktatur kann man nicht mit solchen Sprüchen bekämpfen. Man muss überlegen, wie man das System abschaffen kann – im Zimmer zu sitzen und zu klagen, wie schrecklich Hitler ist, hilft da nicht weiter. Das muss man auch verstehen. Die Leute waren sehr verzweifelt und konnten im Prinzip mit ihren Mitteln auch nichts machen. Macht muss man haben, um so etwas stürzen zu können! In einer Diktatur zählt nur die Macht. Der Kern ist, so viel Macht in die Hand zu bekommen, um die Macht tatsächlich übernehmen zu können. Und diese Diktatur, das muss man zugeben, funktionierte lange fabelhaft, ein erstklassiges System! Und das zu beseitigen war wirklich unsagbar schwer. Das zeigten die Aktivitäten Ihres Vaters, der Jurist war, aber auch preußischer Monarchist und ein stark christlich geprägter Konservativer. Er ist 1938 im Auftrag der Verschwörergruppe um den damaligen Generalstabschef des Heeres Ludwig Beck nach England gefahren, um Unterstützung für die Anti- Hitler-Bewegung zu bekommen? Kleist: Wir haben darüber gesprochen. Aber was sollte England denn machen, wenn da ein Privatmann hinkommt? Es war klar, dass London deswegen nicht seine außenpolitische Haltung ändern wird. Aber es war immerhin ein Versuch, das muss man anerkennen. Bei der Beurteilung des Widerstands vom 20. Juli fällt auf, dass er bei aller Kenntnis der Hintergründe und Personen auch heute noch nicht eindeutig positiv gesehen wird. Kleist: Das Problem bei der historischen Betrachtung der damaligen Zeit ist ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Alle Menschen jener Zeit gelten entweder als kleine Lichter oder als große Verbrecher. Natürlich waren viele Menschen auch fröhlich unter Hitler, zumindest bis zum Beginn des Krieges 1939. Und sie waren von Hitler angetan. Das machte es dem Widerstand ja so schwer. Andererseits gab es selbst im NS-Apparat bis zum Schluss anständige Menschen. Ein Kriminalrat, der bei meinen Verhören anwesend war, hat mir sogar geholfen. Wenn ich nach Personen und Orten gefragt wurde und manchmal mit der Antwort zögerte, hat er unmerklich mit dem Kopf genickt oder ein winziges Zeichen der Ablehnung gemacht. Er hat mir damit indirekt Signale für die Antwort gegeben, so sind mir unangenehme Nachfragen erspart geblieben. Auch der Widerstand hatte einen Maßstab, nach dem er die Menschen klar einteilte, wenn er mit ihnen verkehrte. Da gab es die Nazis und die Anti-Nazis. Und Anti-Nazis gab es sehr wenige. Wir hatten und suchten keinen Zugang zu den Nazis und schon gar nicht zum Kreis um Hitler. Weil man mit denen nichts zu tun haben wollte. Deshalb waren wir auch gar nicht immer auf dem richtigen Dampfer. Uns fehlte der Zugang zu wichtigen Informationen. Unsere Kenntnisse und Vorstellungen, was da wirklich los war, waren sehr begrenzt. Was die Nazis machten, wer von denen was dachte, wussten wir im Widerstand eigentlich nicht. Wer hat Sie von den Mitstreitern am meisten beeindruckt? Kleist: Da gibt es einige. Den Tegeler Gefängnispfarrer Harald Poelchau. Das war ein großartiger Mann. Ich kannte ihn aus dem Gefängnis. Da kam er eines Abends in meine Zelle und fragte mich, ob ich evangelisch oder katholisch sei. Wir haben uns unterhalten. Ich habe läppisch so getan, als ob alles in Ordnung sei mit mir, weil ich ihn nicht einschätzen konnte. Dann sagte er plötzlich ganz offen: "Nein, nein! So geht das nicht. Alle, die hier sind, müssen sich darauf einstellen, dass sie über die Klinge springen müssen." Ich dachte: Na das ist ja ein netter Vertreter des lieben Gottes. Der hat ja gleich die richtige Tröstung parat. Am nächsten Tag habe ich das anderen erzählt, da sagte man mir: "Der Poelchau ist in Ordnung, der gehört zu uns." Schulenburg war einer der wichtigsten Mitstreiter. Neben Stauffenberg und Tresckow. Es gibt kaum einen, der so entschlossen, klar und klug war wie Tresckow. Schulenburg gehört dazu, war aber ganz anders. Die Leute um Goerdeler, Moltke oder die Leute vom Auswärtigen Amt waren sicherlich wichtig für den Widerstand – aber sie bewegten sich doch auf sehr theoretischem Gebiet, und einige wollten nicht die Tat, das Attentat. Was waren aus Ihrer Sicht Hemmnisse für den Widerstand? Kleist: Der Eid auf Hitler und der Satz: Ich muss Rücksicht auf meine Familie nehmen. Beides war nicht zu widerlegen. Bei beiden konnte man nicht wissen, wie wichtig das dem Gegenüber war. Und dann war da immer die Frage: Steht eigentlich die Bevölkerung hinter uns? Was war Ihre eigene Motivation? Kleist: Mich interessierte vor allem das Schicksal der vielen Millionen Menschen. Ich hatte als junger Offizier das Glück, auf unterer militärischer Ebene viele Kriegseinsätze zu überstehen. Die untere Ebene ist wichtig, weil Sie dort eng mit den Leuten zusammenleben, für die Sie zuständig sind. Ich war verantwortlich für das Schicksal dieser Menschen, die mir bedingungslos vertrauten und meine Befehle ausführten. Und dann sehen Sie, wie diese Menschen sterben und verrecken. Ein Bauer, der immer nur traurig war, weil er an seine Felder und seine Familie dachte. Oder der Mensch, der für uns immer gesungen hat, der dann plötzlich mit Bauchschuss dalag und sagte: "Herr Leutnant, jetzt kann ich nicht mehr für Sie singen." Schrecklich. Dann war ich nach einer Verwundung einige Zeit in Berlin im Einsatz. Dort erlebte ich schwere Bombenangriffe auf die Stadt. Und dann kamen die Meldungen der Verschütteten, dort 30, dort zehn. Irgendwo müssen Sie anfangen, diese zu bergen. Wo immer Sie anfangen, das bedeutet, dass Sie für andere zu spät kommen. Und diese Not, die ich gesehen habe, diese Tode – das hat mich bewogen, etwas zu tun. Damit das aufhört, dass diese Millionen Menschen sinnlos sterben. Sie haben 1962 die Münchner Wehrkundetagung gegründet, aus der später die Münchner Sicherheitskonferenz wurde. Einmal im Jahr treffen Militärs und Politiker aus aller Welt zum Austausch zusammen. Inwieweit hat das mit den Erfahrungen im Widerstand zu tun? Kleist: Es geht mir um das Verhältnis zum Krieg. Ich habe gesehen, dass die Politiker kaum Zeit für solche Debatten haben, dass sie eingezwängt sind, auch in parteipolitische Vorgaben. Aber wenn man mit den Leuten einzeln sprach, merkte man schon, dass es Brücken zwischen den Lagern gab. Das wollte ich ausnutzen mit der Konferenz. Es ist dumm zu sagen, in einer Demokratie kann man nichts machen, außer alle paar Jahre zur Wahl zu gehen. Man kann sehr wohl etwas machen. Den Politikern eine Hilfestellung geben. Mit der Erkenntnis, etwas präventiv machen zu können und eine Gesprächsebene zwischen Menschen zu schaffen, die sonst nicht so leicht zueinandergefunden hätten. Die Konferenz war somit ein mächtiges informelles Gremium während des Kalten Krieges. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks habe ich sofort das Motto ausgerufen: Kooperation statt Konfrontation und Siegerposen. Rede als PDF Zurück
© 2013 Dr. Antje
Vollmer